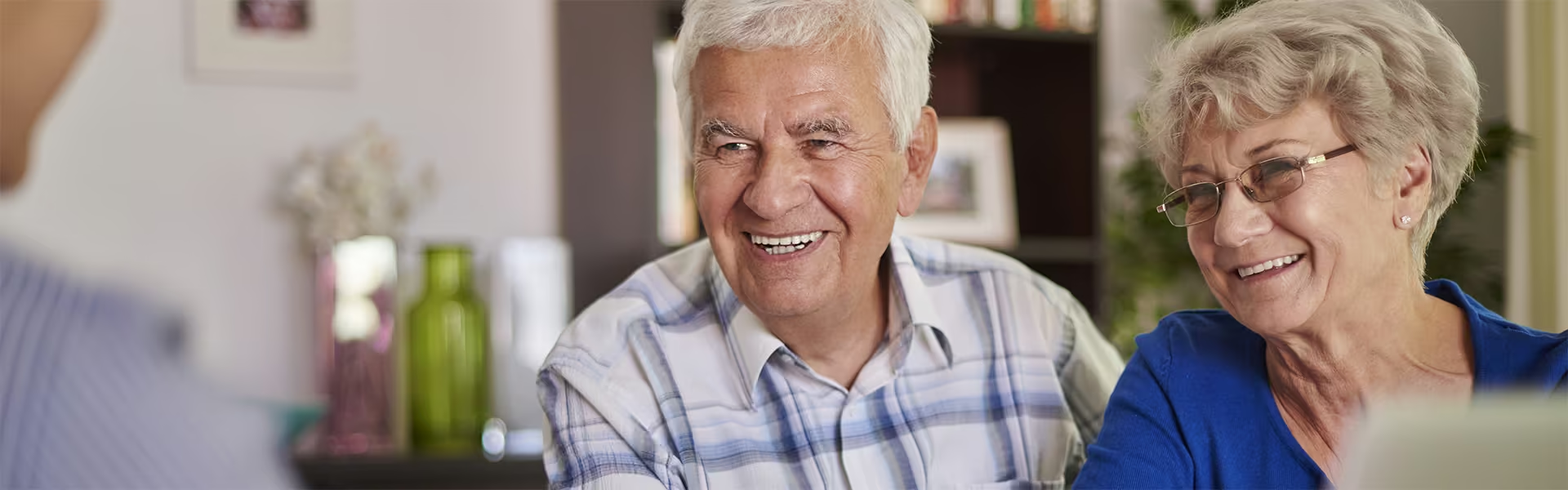Viele Unternehmen nutzen die Pauschalversteuerung von Löhnen nach § 40 EStG, um bestimmte Lohnbestandteile (z. B. Sachzuwendungen, Zuschüsse oder Minijobs) mit einem festen Steuersatz abzugelten. Dabei übernimmt der Arbeitgeber als Steuerschuldner die pauschale Lohnsteuer gemäß § 40 Abs. 3 EStG. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie mit der Kirchensteuer auf solche pauschal versteuerten Entgelte umzugehen ist. Grundsätzlich gilt: Wird Lohnsteuer pauschal erhoben, muss auch die Kirchensteuer entsprechend pauschal berechnet und abgeführt werden. Im Folgenden werden die gesetzlichen Grundlagen erläutert, die Wahlmöglichkeiten des Arbeitgebers (vereinfachtes Verfahren vs. Nachweisverfahren) dargestellt und aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen ein Unternehmen die Kirchensteuer pauschal entrichten kann oder darauf verzichten darf. Zudem wird die Bedeutung der Religionszugehörigkeit der Arbeitnehmer erklärt und Tipps gegeben, wie ein externer Lohnabrechnungsdienst bei diesen Aufgaben unterstützen kann.
Gesetzliche Grundlagen: individuelle vs. pauschale Kirchensteuerpflicht
In Deutschland wird die Kirchenlohnsteuer normalerweise gemeinsam mit der Lohnsteuer vom Arbeitslohn einbehalten. Das heißt, für Kirchenmitglieder beträgt die Kirchensteuer je nach Bundesland 8 % oder 9 % der Lohnsteuer und wird individuell pro Arbeitnehmer erhoben. Bei pauschal versteuerten Entgelten (nach § 40 EStG und verwandten Vorschriften) ändert sich die Situation: Hier trägt der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal und damit grundsätzlich auch die darauf entfallende Kirchensteuer. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich z. B. in § 40 EStG (Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen) sowie in den Kirchensteuerregelungen der Bundesländer (Kirchensteuerordnung bzw. -verordnung) und entsprechenden BMF-Schreiben. So wurden etwa durch gleichlautende Erlasse der Länder vom 8. August 2016 (BStBl 2016 I S. 773) die Regeln für die Erhebung der Kirchensteuer bei pauschaler Lohnsteuer ab 2017 vereinheitlicht und konkretisiert.
Individuelle Kirchensteuerpflicht: Entsteht ein pauschal besteuerter Lohnbestandteil, so hängt die Kirchensteuerpflicht vom einzelnen Arbeitnehmer ab. Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft, fällt für diesen Teil Kirchensteuer in regulärer Höhe (8 % bzw. 9 %) an; gehört er keiner steuererhebenden Kirche an, wird keine Kirchensteuer erhoben. Diese individuelle Zuordnung erfolgt im Rahmen des sogenannten Nachweisverfahrens (siehe unten). In Fällen, in denen keiner der begünstigten Arbeitnehmer kirchensteuerpflichtig ist, entsteht auf das pauschal versteuerte Entgelt überhaupt keine Kirchensteuer – der Arbeitgeber kann die Pauschalierung der Kirchensteuer also faktisch unterlassen, muss dies aber durch entsprechende Nachweise belegen.
Pauschale Kirchensteuerpflicht: Alternativ besteht die Möglichkeit, die Kirchensteuer pauschal für alle Empfänger der pauschal versteuerten Leistung abzuführen. In diesem Fall wird auf die gesamte pauschale Lohnsteuer ein ermäßigter Kirchensteuer-Prozentsatz angewandt. Dieser pauschale Satz berücksichtigt, dass erfahrungsgemäß nicht alle Arbeitnehmer Kirchenmitglieder sind, und liegt je nach Bundesland zwischen 4 % und 7 %. Beispielsweise beträgt der Kirchensteuer-Pauschalsatz in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen u.a. 7 %, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein 6 %, in Baden-Württemberg 4,5 %, in Berlin und Ostdeutschland 5 % und in Hamburg 4 %. Wichtig: Diese pauschale Kirchensteuer wird unabhängig von der individuellen Religionszugehörigkeit für alle pauschal besteuerten Entgelte des betreffenden Anwendungsfalls erhoben. Die Aufteilung der so entrichteten Kirchensteuer auf die einzelnen Kirchen übernimmt anschließend die Finanzverwaltung automatisch.
Wahlrecht des Arbeitgebers: Vereinfachtes Verfahren vs. Nachweisverfahren
Die Finanzverwaltung räumt Arbeitgebern ein Wahlrecht ein, wie sie die Kirchensteuer bei Pauschalversteuerung erheben möchten. Es gibt zwei anerkannte Verfahren:
-
Vereinfachtes Verfahren: Der Arbeitgeber führt für alle betroffenen Arbeitnehmer pauschal Kirchensteuer ab, und zwar mit dem oben erwähnten ermäßigten Einheitssatz. Dieses Verfahren ist administrativ einfach, da keine individuelle Prüfung der Religionszugehörigkeit erforderlich ist. Es hat jedoch zur Folge, dass auch für Arbeitnehmer ohne Kirchenzugehörigkeit Kirchensteuer gezahlt wird – allerdings zu einem vergünstigten Satz. Die im vereinfachten Verfahren berechnete Kirchensteuer ist im Lohnsteuer-Anmeldungsformular gesondert (Kennzahl 47) anzugeben. Vorteil dieses Verfahrens ist die einfache Handhabung; es eignet sich insbesondere, wenn eine Zuordnung der einzelnen Lohnsteueranteile zu Mitarbeitern schwierig ist (z. B. bei Sachzuwendungen an Nicht-Arbeitnehmer) oder wenn ein Großteil der Belegschaft ohnehin kirchensteuerpflichtig ist. In solchen Fällen kann der Einheitssatz sogar zu einer Kostenersparnis für den Arbeitgeber führen, wenn er unter dem regulären Satz von 8/9 % liegt.
-
Nachweisverfahren: Hierbei ermittelt der Arbeitgeber für jeden Empfänger pauschal versteuerten Arbeitslohns, ob eine Kirchensteuerpflicht besteht. Für Arbeitnehmer, die keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehören, wird keine Kirchensteuer abgeführt; für alle Kirchenmitglieder wird die Kirchensteuer mit dem allgemeinen Satz des jeweiligen Bundeslands (8 % oder 9 %) auf den individuell zurechenbaren Lohnsteuerbetrag berechnet. Als Nachweis der Religionszugehörigkeit dienen in der Regel die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ELStAM (darin ist die Konfession vermerkt) oder – falls ELStAM für den Mitarbeiter nicht vorliegt – eine vom Finanzamt ausgestellte Ersatzbescheinigung. In Fällen, in denen ELStAM nicht genutzt wird (z. B. bei kurzfristig Beschäftigten oder Sachzuwendungen an Dritte), kann der Arbeitgeber eine schriftliche Erklärung des Empfängers über dessen (Nicht-)Kirchensteuerpflicht einholen. Ein amtliches Musterformular für diese Erklärung steht zur Verfügung und muss als Beleg aufbewahrt werden. Die Entscheidung für das Nachweisverfahren erfordert also etwas mehr Verwaltungsaufwand, bietet jedoch den Vorteil, dass der Arbeitgeber nur dann Kirchensteuer zahlt, wenn tatsächlich eine Kirchensteuerpflicht besteht. Die im Nachweisverfahren ermittelte Kirchensteuer wird in der Lohnsteuer-Anmeldung unter den jeweiligen Kirchensteuer-Kennziffern (z. B. 61 für evangelisch, 62 für katholisch) gemeldet.
Flexible Anwendung: Das Wahlrecht kann sehr flexibel ausgeübt werden. Der Arbeitgeber darf für jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum neu entscheiden und auch je nach Pauschalierungstatbestand unterschiedlich verfahren. Das bedeutet, er kann z. B. für pauschal versteuerte Sachbezüge das vereinfachte Verfahren nutzen, für pauschal versteuerte Direktversicherungsbeiträge hingegen das Nachweisverfahren – je nachdem, was praktikabler ist. Ein Wechsel der Methode ist sogar innerhalb des Jahres möglich, da die Pauschalsteuer stets periodenbezogen endgültig ist. Diese Flexibilität erlaubt es Unternehmen, die für sie optimal passende Methode zu wählen, ohne formal an eine einmalige Jahresentscheidung gebunden zu sein.
Voraussetzungen und Sonderfälle der pauschalen Kirchensteuer
Grundvoraussetzung für die hier beschriebenen Wahlmöglichkeiten ist, dass der betreffende Lohnbestandteil überhaupt nach § 40 EStG (bzw. § 40a, § 37b EStG etc.) pauschal versteuert wird. Ist dies der Fall, ergibt sich automatisch die Verpflichtung (bzw. das Recht) zur entsprechenden Behandlung der Kirchensteuer. Nur in einem Sonderfall ist keine gesonderte Kirchensteuerabführung erforderlich: Bei geringfügig entlohnten Beschäftigten (Minijobs), für die der Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer von 2 % wählt, entfällt eine zusätzliche Kirchensteuer-Pauschalierung vollständig. Die 2%ige Pauschsteuer gilt laut Gesetz inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer und begleicht damit sämtliche Abgaben. Anders ausgedrückt: Zahlt der Arbeitgeber für einen Minijob die Pauschsteuer von 2 %, müssen weder er noch der Arbeitnehmer Kirchensteuer auf diesen Lohn entrichten. (Alternativ kann der Arbeitgeber auch bei Minijobs auf die Pauschalsteuer verzichten und nach Lohnsteuerkarte abrechnen; dann würde – abhängig von der Steuerklasse und Höhe des Entgelts – gegebenenfalls individuell Lohn- und Kirchensteuer anfallen.)
Außerhalb der 2%-Minijobs gilt jedoch: Verzichtet ein Unternehmen auf die pauschale Kirchensteuerabführung, so ist dies nur dann zulässig, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht – konkret also, wenn im Nachweisverfahren keine Kirchensteuerpflicht festgestellt wurde. Ansonsten würde ein Unterlassen der Kirchensteuerabführung eine Pflichtverletzung darstellen. Unternehmen müssen daher im Nachweisverfahren sorgfältig dokumentieren, welche Arbeitnehmer kirchensteuerpflichtig sind und welche nicht. Liegt für einzelne Empfänger kein Nachweis vor, muss der Arbeitgeber aus Sicherheitsgründen den normalen Kirchensteuersatz anwenden (Annahme einer Kirchenzugehörigkeit). Dies soll verhindern, dass versehentlich für Kirchenmitglieder keine Kirchensteuer gezahlt wird. Zudem ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Zugehörigkeit in seinen Lohnunterlagen (Lohnkonto) zu vermerken. Werden alle Vorgaben eingehalten, darf das Unternehmen im Ergebnis für Nicht-Kirchenmitglieder auf die Kirchensteuerzahlung verzichten, während es für Kirchenmitglieder die Steuer entrichtet. Die Finanzbehörden kontrollieren über die Lohnsteuer-Anmeldung (und ggf. Betriebsprüfungen), ob die gewählte Methode korrekt angewandt wurde.
Bedeutung der Religionszugehörigkeit der Arbeitnehmer
Die Konfession der Arbeitnehmer spielt bei pauschal versteuerten Löhnen eine zentrale Rolle. Sie entscheidet darüber, ob und in welcher Höhe Kirchensteuer anfällt. Im vereinfachten Verfahren wird zwar auf eine Prüfung verzichtet, doch fließt die Religionszugehörigkeit indirekt in die Festlegung des ermäßigten Steuersatzes ein – dieser wurde so bemessen, dass er statistisch die Mischung aus Kirchenmitgliedern und Konfessionslosen in der Bevölkerung berücksichtigt. Im Nachweisverfahren hingegen ist die Konfession jedes einzelnen Mitarbeiters unmittelbar relevant: Nur wenn ein Arbeitnehmer tatsächlich Mitglied einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft ist, wird für seinen Anteil am pauschalen Lohn eine Kirchensteuer berechnet. Mitarbeiter ohne Kirchenzugehörigkeit bleiben von der Kirchensteuer unberührt, wodurch das Unternehmen in diesen Fällen Kosten spart.
Für Arbeitgeber bedeutet das: Es lohnt sich, die Religionsmerkmale der Belegschaft im Blick zu haben (natürlich unter Beachtung des Datenschutzes). Sind z. B. viele Empfänger der pauschal versteuerten Vorteile nicht kirchensteuerpflichtig, kann das Nachweisverfahren finanziell vorteilhafter sein, da man keine unnötige Kirchensteuer abführt. Umgekehrt kann in einer Belegschaft mit überwiegend kirchensteuerpflichtigen Mitarbeitern das vereinfachte Verfahren einfacher und eventuell kostengünstiger sein, weil ein reduzierter Einheitssatz gilt. Eine gezielte “Vermeidung” der Kirchensteuer auf pauschale Löhne ist rechtlich nur im Rahmen dieser Wahlmöglichkeiten möglich – etwa indem man das Nachweisverfahren nutzt, wo angebracht, oder indem man für steuerfreie Mitarbeiterkreise keine Pauschalversteuerung einsetzt. Ein extremes Mittel wäre der Kirchenaustritt von Mitarbeitern, was ihre Kirchensteuerpflicht generell beendet; dies liegt aber allein in der Entscheidung des Arbeitnehmers und kann vom Arbeitgeber weder gefordert noch gefördert werden. In der Praxis sollten Unternehmen vielmehr auf korrekte Verfahren setzen, anstatt auf persönliche Entscheidungen der Mitarbeiter zu spekulieren.