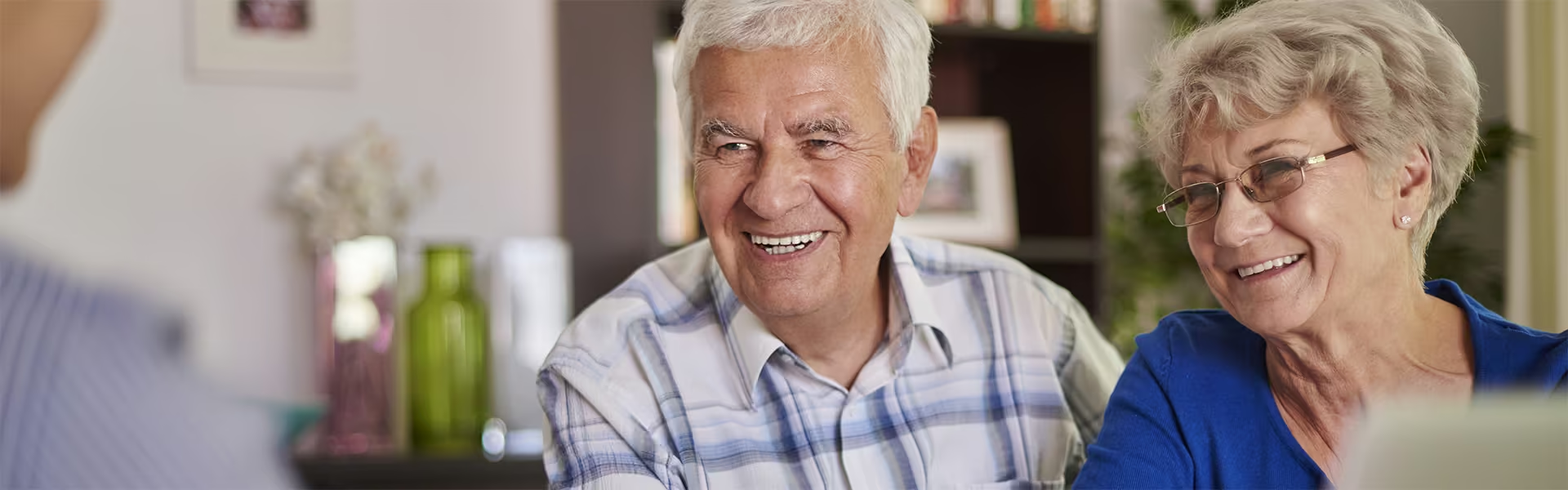Zwischenzeitlich haben sich seit dem Erstellen des ersten Newsletters Neuerungen ergeben, die wir Ihnen hier ebenfalls präsentieren
2. Newsletter 2025/2026 – Stand: 15.12.2025
Wie bereits im Newsletter vom 07.11.2025 mitgeteilt, waren einige der Änderungen noch nicht beschlossen. Es sind noch weitere Änderungen hinzugekommen. Wir wollen Sie hierzu entsprechend erneut informieren und Ihnen mitteilen, dass noch weitere Änderungen möglich sind.
Erweiterter Branchenkatalog ab 2026
Ab 01. Januar 2026 gelten Sofortmeldungen in zusätzlichen Wirtschaftszweigen. Neu hinzu
kommen das Friseur- und Kosmetikgewerbe sowie plattformbasierte Lieferdienste (z.B. Kurier- und Essenslieferdienste). Entfallen wird die Pflicht hingegen für die Forstwirtschaft und für das Fleischerhandwerk, also insbesondere kleine Metzgereibetriebe. Unverändert gilt die Sofortmeldepflicht weiterhin für alle bereits zuvor erfassten Branchen – dazu zählen etwa das Baugewerbe, das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Personenbeförderung (z.B. Taxi), Spedition und Logistik, das Schaustellergewerbe, die Gebäudereinigung, Messe- und Ausstellungsbau, die größere Fleischwirtschaft (ohne Handwerksmetzgereien), das Prostitutionsgewerbe sowie das Wach- und Sicherheitsgewerbe. In diesen Branchen sind Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung erfahrungsgemäß besonders verbreitet, daher unterliegen sie der besonderen Meldepflicht.
Mit der Aufnahme neuer Branchen gehen für dortige Arbeitgeber dieselben Pflichten einher
wie in den bisherigen sofortmeldepflichtigen Branchen. Insbesondere müssen neu eingestellte Arbeitnehmer vor Arbeitsantritt durch eine Sofortmeldung gemeldet werden. Außerdem gilt in allen betroffenen Branchen eine Mitführungs- und Ausweispflicht: Arbeitnehmer müssen bei der Arbeit ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Pass) mitführen und Behörden bei Kontrollen vorzeigen können. Neu ab 2026 ist hierbei eine Hinweispflicht: Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter schriftlich über die Ausweispflicht informieren und den Nachweis dieser Unterweisung zu den Entgeltunterlagen nehmen. Auch die bereits bestehende Verpflichtung zur Arbeitszeitdokumentation gilt dann für die neuen Branchen – das heißt, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit jedes Beschäftigten müssen spätestens innerhalb von 7 Tagen erfasst und zwei Jahre lang aufbewahrt
werden (§ 17 MiLoG).
Wir benötigen hier Ihre Mitarbeit
Ist Ihr Unternehmen von der Sofortmeldepflicht betroffen, kann Lohndirekt für Sie die
Sofortmeldungen übernehmen. Gerne erstellen wir dazu ein Angebot für Sie. Wenden Sie sich dazu direkt an Ihren persönlichen Lohnsachbearbeiter / Ihre persönliche Lohnsachbearbeiterin. Sollten wir bisher für Sie die Sofortmeldungen erstellt haben, Ihr Unternehmen nun aber durch die o.g. Änderungen nicht mehr in die Sofortmeldepflicht fallen, informieren Sie uns bitte ebenfalls. Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Unternehmen einem sofortmeldepflichtigen Wirtschaftszweig zugeordnet ist, dann kontaktieren Sie eine Krankenkasse, bei welcher Sie aktive Mitarbeiter/innen beschäftigt haben.
Aktuelle Regelungen zur Kostenerstattung (bis Ende 2025)
Erstattung von Stromkosten beim Laden zuhause: Wird der Dienstwagen (betriebliches Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug) allerdings zuhause aufgeladen und bezahlt der Arbeitnehmer zunächst die Stromkosten selbst, kann der Arbeitgeber diese Kosten steuer -und sozialabgabenfrei ersetzen – dies gilt als Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 EStG. Bis Ende 2025 durfte der Arbeitgeber hierfür monatliche Pauschalbeträge ansetzen, ohne dass ein technischer Nachweis des Verbrauchs erforderlich war. Diese Pauschalen vereinfachten die Abrechnung erheblich: Der Mitarbeiter erhielt einen fixen Betrag pro Monat steuerfrei zurückerstattet, unabhängig von den tatsächlich geladenen kWh. Die Höhe der Pauschale
richtete sich nach Fahrzeugtyp und der Frage, ob der Arbeitgeber im Betrieb eine Lademöglichkeit bereitstellt:
-
Mit Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: Elektrofahrzeug 30 € monatlich, Plugin-Hybride 15 € monatlich. (Eine zusätzliche Lademöglichkeit liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer die betrieblichen Ladeeinrichtungen auch nutzen darf.)
-
Ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: Elektrofahrzeug 70 € monatlich, Plugin-Hybride 35 € monatlich.
Diese Pauschalbeträge waren steuerfrei und mussten nicht individuell nachgewiesen werden. Voraussetzung war allerdings, dass es sich um einen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen handelte. Kein steuerfreier Auslagenersatz war möglich, wenn es sich um das private E-Fahrzeug des Arbeitnehmers handelte – übernimmt der Arbeitgeber Stromkosten für ein reines Privatfahrzeug, gilt dies als normaler Arbeitslohn und wäre steuer- bzw. beitragspflichtig. Die genannten Pauschalen nach dem vereinfachten Verfahren gelten nur noch bis 31. Dezember 2025. Für Lohnzahlungszeiträume ab 2026 dürfen sie nicht mehr angewendet werden.
Änderungen ab 2026 – Ende der Pauschalen und neue Nachweispflichten
Erstattung zum offiziellen Durchschnittspreis (neue Pauschale): Alternativ kann zur Vereinfachung ein amtlicher Durchschnittsstrompreis verwendet werden. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht halbjährlich den Durchschnittspreis für Haushaltsstrom (inkl. Steuern und Abgaben) für verschiedene Verbrauchsgruppen. Für das erste Halbjahr 2025 wurde dieser Referenzpreis mit 34 Cent pro kWh angegeben. Diese sogenannte Strompreispauschale (0,34 €/kWh) wird mit der nachgewiesenen geladenen Strommenge multipliziert. Sie deckt sämtliche Kosten der häuslichen Ladevorrichtung ab – das heißt, darin sind pauschal auch eventuelle Grundgebühren und Nebenkosten abgegolten. Wichtig: Der Arbeitnehmer muss dazu die tatsächlich für den Dienstwagen genutzten Verbrauch nachweisen.
Durch dieses System kann der Erstattungsbetrag deutlich variabler ausfallen als bisher.
Beispiel: Lädt ein Mitarbeiter im Jahr 2026 insgesamt 3.000 kWh für seinen Dienstwagen
zuhause, so erhielte er bei Ansatz der Strompreispauschale 0,34 €/kWh einen Ersatz von 1.020 € für das Jahr. Zum Vergleich: Nach altem Recht wäre der Pauschalersatz bei 70 €/ Monat auf 840 € jährlich begrenzt gewesen. Viel-Lader können also mehr zurückbekommen als bisher, während Wenig-Lader künftig nur noch ihre tatsächlich angefallenen geringeren Kosten erstattet bekommen (die früher eventuell pauschal überkompensiert wurden). Unterm Strich erhöht sich die Kostengerechtigkeit, da der Ersatz exakt am Verbrauch ausgerichtet ist.
Im letzten Newsletter hatten wir informiert, dass die Pendlerpauschale ab 2026 auf 0,38
€ je Entfernungskilometer erhöht wird. Das gilt für Arbeitgeber-Zuschüsse zu den Fahrten Wohnung – 1. Tätigkeitsstätte. Bis Ende 2025 gelten hier 0,30 € je Entfernungskilometer und 0,38 € erst ab den 21. Entfernungskilometer. Wir möchten hier noch einmal hinweisen, dass diese Erhöhung nicht für Fahrtkostenerstattungen gilt. Erstatten Sie also Fahrtkosten für dienstliche Fahrten mit dem privaten PKW durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dann bleibt es hier bei 0,30 €. Allerdings gelten diese je tatsächlich gefahrenen Kilometer. Jeder Betrag, welcher darüber hinaus geht, stellt einen steuerpflichtigen Arbeitslohn da.
Des Weiteren hatten wir berichtet, dass der Gesetzgeber ab 2026 die Möglichkeit schaffen
wollte, unter gewissen Voraussetzungen Überstundenzuschläge steuerfrei auszuzahlen zu können. Zudem war geplant, die Möglichkeit zu schaffen, dass für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Teilzeit bei einer Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit eine steuerfreie Prämie ausgezahlt werden kann.
Diese beiden Punkte wurden Anfang Dezember aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Eine
Einführung ist also zumindest für Anfang 2026 nicht wahrscheinlich. Wir halten Sie natürlich über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.
Den Weg durch den Bundestag hat die Aktivrente dagegen geschafft und wird aller Voraussicht nach für 2026 kommen. Es fehlt noch die Zustimmung durch den Bundesrat und vor allem ein Leitfaden für die Umsetzung in der Praxis. Trotzdem wollen wir diese hier schon einmal vorstellen. Ab 01.01.2026 erhalten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab dem ersten Monat, welcher auf das Überschreiten der Regelaltersgrenze folgt, einen zusätzlichen steuerlichen Freibetrag von 2.000,00 € je Monat. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass es sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handelt.
Dieser zusätzliche Freibetrag gilt bei mehreren Beschäftigungen nur für die Hauptbeschäftigung und kann nicht aufgeteilt werden, sofern mehrere Beschäftigungsverhältnisse vorliegen. Des Weiteren gelten die 2.000,00 € monatlich. Ein nicht verbrauchter Freibetrag kann nicht auf einen anderen Abrechnungsmonat übertragen werden.
Die 2.000,00 € unterliegen nicht dem Progressionsvorbehalt, wohl aber der Sozialversicherungspflicht. Da zur Verkündung des Gesetzes noch die Zustimmung des Bundesrates fehlt, rechnen wir damit, dass die Umsetzung erst im Frühjahr 2026 folgt, wodurch entsprechend Korrekturen anfallen werden. Aber vielleicht überrascht uns hier noch der Gesetzgeber. Wir werden Sie hier entsprechend weiter informieren.
1. Newsletter 2025/2026 – Stand: 07.11.2025
2026 bringt eine Reihe wichtiger Änderungen in Steuerrecht, Sozialversicherung und Lohnabrechnung. Dieser Überblick zeigt die zentralen Neuerungen für Arbeitgeber, Minijobber, Fachkräfte und Unternehmen. Die Inhalte basieren auf den offiziellen Änderungen sowie den ergänzenden Hinweisen von Lohndirekt.
Ab dem 1. Januar 2026 gilt eine höhere Pendlerpauschale (Entfernungspauschale) für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Künftig können Arbeitnehmer 38 Cent pro Entfernungskilometer steuerlich geltend machen. Bisher waren es 30 Cent je Kilometer für die ersten 20 km und erst ab dem 21. Kilometer 38 Cent. Die bisherige Staffelung entfällt damit, sodass die erhöhte Pauschale einheitlich ab dem ersten Kilometer greift. Diese Änderung ist dauerhaft angelegt und soll insbesondere Pendler mit kürzeren Arbeitswegen stärker entlasten.
Laut offizieller Mitteilung bringt die Erhöhung der Entfernungspauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer mehr steuerliche Gerechtigkeit zwischen Stadt- und Landbewohnern und entlastet Pendler mit weiten Arbeitswegen spürbar. Beispielsweise ergibt sich bei einer Fünf-Tage-Woche durch die Neuregelung für einen einfachen Arbeitsweg von 10 Kilometern eine zusätzliche absetzbare Summe von etwa 176 Euro pro Jahr. Für die Lohnabrechnung bedeutet dies, dass ab 2026 höhere Werbungskosten aus Fahrten zum Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Arbeitnehmer, die einen Freibetrag für Fahrtkosten beim Finanzamt eingetragen haben, können diesen zum Jahreswechsel anpassen, um bereits unterjährig von der Entlastung zu profitieren. Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden einen Fahrtkostenzuschuss gewähren, können dessen Höhe entsprechend anheben, da der maximal steuerbegünstigte Zuschuss sich an der erhöhten Pendlerpauschale orientiert.
Zum 1. Januar 2026 treten im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2025 wichtige Verbesserungen für ehrenamtlich Engagierte in Kraft: Die Übungsleiterpauschale wird von 3.000 € auf 3.300 € angehoben, und die Ehrenamtspauschale steigt von bisher 840 € auf 960 € jährlich.
Anwendungsbereiche & Voraussetzungen
-
Die Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 EStG) gilt für nebenberufliche Tätigkeiten in den Bereichen Sport, Bildung, Erziehung, Pflege oder Kultur bei gemeinnützigen Organisationen. Einnahmen bis zu 3.300 € jährlich bleiben steuer- und sozialversicherungsfrei.
-
Die Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EStG) kann für andere nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Vorstand, administrative Mitarbeit) bei gemeinnützigen Körperschaften angewendet werden. Bis 960 € jährlich sind Vergütungen steuerfrei.
-
Beide Pauschalen gelten nur unter der Voraussetzung einer nebentätigen Ausübung, d. h. sie dürfen das Ausmaß von etwa einem Drittel der üblichen Arbeitszeit nicht überschreiten.
-
Werden sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtspauschale beansprucht, ist eine klare sachliche Trennung der Tätigkeiten erforderlich (z. B. unterschiedliche Organisationen).
Rückwirkend zum 1. Juli 2025 wurde die Bruttolistenpreisgrenze für steuerlich begünstigte vollelektrische Dienstwagen von bisher 70.000 € auf 100.000 € erhöht. Dank der erhöhten Preisgrenze können rein elektrische Firmenwagen bis zu einem Listenpreis von 100.000 € von der Viertelung des Bruttolistenpreises für Privatnutzung profitieren.
Das bedeutet, dass für private Fahrten und Fahrten Wohnung – 1. Tätigkeitsstätte monatlich nur 1% des geviertelten Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil versteuert werden müssen – anstelle des ungekürzten Bruttolistenpreises bei herkömmlichen Verbrenner- Fahrzeugen. Übersteigt der Listenpreis die 100.000 €-Marke, vermindert sich der Vorteil auf den halbierten Bruttolistenpreis. Die neue Grenze gilt für Fahrzeuge, die ab dem 1.Juli 2025 angeschafft wurden, und erweitert damit den Kreis der begünstigten Elektro-Modelle deutlich.
Arbeitgeber profitieren insofern, als sie ihren Mitarbeitern nun auch höherwertige Elektroautos mit attraktivem Steuervorteil bei privater Nutzung zur Verfügung stellen können. Die Maßnahme soll zugleich einen Anreiz für mehr Elektromobilität schaffen und den heimischen Automobilsektor stärken. Dabei bleibt die Förderung zeitlich befristet: Nach geltendem Recht ist diese Regelung für E-Dienstwagen bis Ende 2030 vorgesehen. Wichtig zur Einordnung ist noch zu wissen, dass der Bruttolistenpreis immer zum Zeitpunkt der Erstzulassung zu ermitteln ist. Bei der 100.000 €-Grenze greift dagegen der Zeitpunkt der Anschaffung.
Änderungen ab 1. Januar 2026
Ab dem 1. Januar 2026 tritt eine neue gesetzliche Regelung in Kraft, die das bisherige Papierverfahren zur Bescheinigung privater Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ablöst. Künftig erfolgt ein digitaler Datenaustausch zwischen den privaten Kranken- und Pflegeversicherern, dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und den Arbeitgebern. Arbeitnehmer müssen ihrem Arbeitgeber dann keine Beitragsbescheinigungen mehr vorlegen; die relevanten Beitragsdaten werden über das ELStAM-Verfahren elektronisch bereitgestellt. Dieses digitale Verfahren soll Bürokratie abbauen und die Lohnsteuerberechnung effizienter machen. Lohndirekt empfängt und übernimmt diese Meldungen automatisch in Ihre Abrechnung.
Von Ihnen ist kein weiteres Zutun mehr notwendig.
Übermittelte Beiträge und Meldepflicht
Übermittelt werden ausschließlich die Beiträge zur privaten Basiskrankenversicherung und zur privaten Pflegepflichtversicherung, die für den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss (§ 3 Nr. 62 EStG) und den Sonderausgabenabzug (Vorsorgeaufwendungen) relevant sind. Zusatzversicherungen bleiben unberücksichtigt. Mitteilungspflichtig sind die privaten Versicherungsunternehmen; sie müssen die Daten spätestens bis zum 20. November des Vorjahres an das BZSt melden. Das BZSt stellt diese Beitragsdaten den Arbeitgebern als elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) zur Verfügung. Arbeitnehmer selbst sind nicht meldepflichtig. Arbeitgeber dürfen im Lohnsteuerabzug ab 2026 nur noch die über ELStAM gemeldeten Monatsbeiträge berücksichtigen.
Auswirkungen auf die Lohnabrechnung
Durch die elektronische Meldung fließen die tatsächlich gezahlten privaten Kranken- und
Pflege-Beiträge automatisch in die monatliche Lohnsteuerberechnung ein. Die bisherige Mindestvorsorgepauschale entfällt ab 2026. Arbeitgeber profitieren von reduziertem Verwaltungsaufwand und weniger Fehlerquellen. Den Abruf und die Übernahme übernehmen wir natürlich im Rahmen der monatlichen Gehaltsabrechnung für Sie. Wir benötigen keine Papiernachweise mehr von Ihnen.
Einleitung
Mit der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 werden die wichtigsten Grenzwerte der Sozialversicherung zum 1. Januar 2026 turnusgemäß an die Lohnentwicklung angepasst. Grundlage ist die bundesweite Lohnsteigerung von 5,16 % im Jahr 2024. Entsprechend steigen alle Rechengrößen für 2026 vergleichsweise stark an. Die neuen Werte betreffen insbesondere die Beitragsbemessungsgrenzen in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, die Bezugsgröße, die Jahresarbeitsentgeltgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung sowie die steuerund sozialversicherungsfreien Höchstbeträge für die betriebliche Altersversorgung.
Hinweis: Seit dem 1. Januar 2025 gelten in ganz Deutschland einheitliche Rechengrößen; die Unterscheidung nach West und Ost entfällt. Im Folgenden sind die Rechengrößen 2026 im Vergleich zu 2025 tabellarisch dargestellt.
Beitragsbemessungsgrenzen 2025/2026
Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) markiert das Einkommen, bis zu dem Beiträge zur
jeweiligen Sozialversicherung erhoben werden – darüber hinausgehende Einkommensteile bleiben beitragsfrei. Durch die positive Lohnentwicklung werden die BBG im Jahr 2026 deutlich angehoben. Beispielsweise steigt die BBG in der allgemeinen Renten- und Arbeitslosenversicherung um 400 € auf 8.450 € monatlich. Die folgende Tabelle zeigt die BBG 2026 im Vergleich zum Vorjahr:
|
Beitragsbemessungsgrenze (Versicherung) |
2025 |
2026 |
|---|---|---|
|
Kranken- und Pflegeversicherung (bundeseinheitlich) |
66.150 € jährlich / 5.512,50 € monatlich |
69.750 € jährlich / 5.812,50 € monatlich |
|
Renten- und Arbeitslosenversicherung (allgemein) |
96.600 € jährlich / 8.050,00 € monatlich |
101.400 € jährlich / 8.450,00 € monatlich |
Erläuterung: In der Kranken- und Pflegeversicherung gelten dieselben Beitragsbemessungsgrenzen, da die Pflegeversicherungs-Beiträge auf der gleichen Einkommensbasis wie die Krankenversicherung berechnet werden. Entsprechendes gilt für die Renten- und Arbeitslosenversicherung, die ebenfalls die gleiche BBG teilen. Man erkennt, dass z. B. in der gesetzlichen Krankenversicherung 2026 maximal Einkommen bis 69.750 € pro Jahr (5.812,50 € pro Monat) für Beitragszwecke herangezogen wird – im Jahr 2025 lag diese Grenze noch bei 66.150 € jährlich (5.512,50 € mtl.). In der allgemeinen Renten- und Arbeitslosenversicherung erhöht sich die BBG von 96.600 € (2025) auf 101.400 € jährlich im Jahr 2026.
Die Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) dient als allgemeine Rechengrundlage in der Sozialversicherung, z. B. für Mindestbeitragsbemessungen, Einkommensgrenzen der Familienversicherung oder bestimmte Freibeträge. Sie wird ebenfalls jährlich an die Lohnentwicklung angepasst. Ab 2025 gilt auch hier ein einheitlicher Wert für das gesamte Bundesgebiet.
|
Bezugsgröße (Sozialversicherung) |
2025 |
2026 |
|---|---|---|
|
(bundeseinheitlich) monatlich / jährlich |
44.940 € jährlich / 3.745 € monatlich |
47.460 € jährlich / 3.955 € monatlich |
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG), oft Versicherungspflichtgrenze genannt, bezeichnet das Bruttojahreseinkommen, ab dem Arbeitnehmer nicht mehr der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen. Wer mit dem regelmäßigen Jahresentgelt diese Grenze überschreitet, kann sich entweder freiwillig gesetzlich versichern oder in eine private Krankenversicherung wechseln. Für die allgemeine Versicherungspflichtgrenze gilt 2026 ein Wert von 77.400 € pro Jahr, gegenüber 73.800 € im Jahr 2025. Dies entspricht einer Anhebung um ca. 4,9 %.
|
Jahresarbeitsentgeltgrenze (KV/PV) |
2025 |
2026 |
|---|---|---|
|
Allgemeine Versicherungspflichtgrenze (jährlich) |
73.800 € |
77.400 € |
Für Arbeitnehmer, die bereits am 31. Dezember 2002 wegen Überschreitens der damals gültigen Grenze privat krankenversichert waren, gilt eine besondere JAEG. Diese liegt 2026 bei 69.750 € und entspricht damit der Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung (2025: 66.150 €).
Für Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung über Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds gelten bestimmte Höchstbeträge, bis zu denen diese vom Arbeitslohn steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt sind. Nach § 3 Nr. 63 EStG sind Beiträge steuerfrei bis zu 8 % der BBG in der allgemeinen Rentenversicherung. Bis zu 4 % der BBG sind zugleich nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV sozialversicherungsfrei (beitragsfrei). Zusätzlich bleibt ein fester Betrag von 1.800 € pro Jahr steuerfrei (§ 3 Nr. 63 EStG), der jedoch – falls genutzt – über die 8%-Grenze hinausgeht und nicht von Sozialabgaben befreit ist. Die Werte für 2025 und 2026 stellen sich wie folgt dar:
|
Höchstbeitrag bAV (Direktversicherung/PK/Pensionsfonds) |
2025 |
2026 |
|---|---|---|
|
Steuerfrei – Beiträge bis 8 % der BBG RV (jährlich) |
7.728 € |
8.112 € |
|
Sozialversicherungsfrei – Beiträgebis 4 % der BBG RV (jährlich) |
3.864 € |
4.056 € |
|
Zusätzlich steuerfrei (pauschaler Höchstbetrag jährlich) |
1.800 € |
1.800 € |
Der steuerfreie Höchstbetrag nach § 3 Nr. 63 EStG umfasst insgesamt 8 % der jeweiligen BBG der Rentenversicherung (jedoch ohne Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen RV). Innerhalb dieses Volumens bleibt die Hälfte (4 % der BBG) sozialabgabenfrei. Für 2026 sind somit Beiträge von bis zu 8.112 € pro Jahr steuerfrei (davon 4.056 € auch SV-frei). Im Jahr 2025 lagen diese Grenzen noch bei 7.728 € bzw. 3.864 €. Der zusätzliche Pauschbetrag von 1.800 € jährlich kann steuerfrei genutzt werden, soweit kein älterer Vertrag mit Pauschalbesteuerung (§ 40b EStG a. F.) besteht. Sozialversicherungsfreiheit besteht für diesen zusätzlichen Betrag nicht.
Neuer Mindestlohn ab 1. Januar 2026
Zum 1. Januar 2026 wird der gesetzliche Mindestlohn auf 13,90 € brutto pro Stunde angehoben (ab 2027 dann 14,60 €). Für Arbeitgeber bedeutet dies steigende Lohnkosten und erfordert insbesondere im Bereich geringfügiger Beschäftigungen einige Anpassungen.
Dynamische Anhebung der Minijob-Grenze
Seit Oktober 2022 ist die Entgeltgrenze für Minijobs dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt. Steigt der Mindestlohn, erhöht sich automatisch auch die zulässige Verdienstgrenze. Grundlage ist eine wöchentliche Arbeitszeit von 10 Stunden zum Mindestlohn (Formel: Mindestlohn × 130 Stunden ÷ 3 Monate). Durch die neue Mindestlohnhöhe steigt die monatliche Minijob-Verdienstgrenze zum 1. Januar 2026 von bisher 556 € auf 603 €. (Zum Vergleich: Anfang 2025 war die Grenze analog von 538 € auf 556 € gestiegen.)
Diese Kopplung stellt sicher, dass ein Minijob weiterhin etwa zehn Wochenstunden umfassen kann, ohne den Minijob-Status zu verlieren. Arbeitgeber müssen in der Praxis also keine Reduzierung der Stundenzahl vornehmen, wenn Minijobber zum gesetzlichen Mindestlohn beschäftigt sind. In anderen Fällen (z. B. höherer Stundenlohn) sollte jedoch geprüft werden, ob die vereinbarte Arbeitszeit angepasst werden muss, damit das monatliche Entgelt unter der neuen Grenze bleibt. Beachten Sie hierbei auch die Dokumentationspflicht: Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, die Arbeitszeiten von Minijobbern aufzuzeichnen – bei steigendem Stundenlohn ist dies umso wichtiger, um die Einhaltung der Verdienstgrenze nachzuweisen.
Auswirkungen auf bestehende Minijobs und Midijobs
Die Anhebung des Mindestlohns und der Minijob-Grenze wirkt sich direkt auf bestehende Beschäftigungsverhältnisse aus. Minijobber, die bisher zum Mindestlohn tätig waren, können ab 2026 bei gleicher Stundenzahl etwas mehr verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Midijobber im sogenannten Übergangsbereich (Verdienst oberhalb der Minijob-Grenze) profitieren ebenfalls: Die Untergrenze des Übergangsbereichs verschiebt sich entsprechend von derzeit 556,01 € auf 603,01 € monatlich (die Obergrenze bleibt bei 2.000 €). Nach § 20 Abs. 2 SGB IV gilt damit ab 2026 jedes regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt über 603 € als sozialversicherungspflichtiger Midijob.
Vorsicht ist geboten, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen, deren regelmäßiges Entgelt bislang knapp über der alten Minijob-Grenze lag (z. B. 570–600 € monatlich). Solche Beschäftigte würden bei unverändertem Lohn ab 2026 unter die neue 603 €-Grenze fallen und damit ihren sozialversicherungspflichtigen Status verlieren. Konkret würde ein bisher versicherungspflichtiger Arbeitnehmer mit 600 € Monatsverdienst ab 1. Januar 2026 aus der Kranken‑, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung herausfallen – der Job gälte dann als Minijob. Warum bleiben diese Arbeitnehmer nicht automatisch versichert? Weil ihr regelmäßiges Entgelt nicht mehr „oberhalb“ der Minijob-Grenze liegt. Um den Sozialversicherungsschutz
solcher Beschäftigten aufrechtzuerhalten, müsste das monatliche Entgelt zum Jahreswechsel auf über 603 € angehoben werden. Andernfalls ist eine Umstufung zum Minijob unumgänglich. In diesem Fall muss der Arbeitnehmer zum 31. Dezember 2025 bei der Krankenkasse abgemeldet und ab 1. Januar 2026 bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden.
Mindestausbildungsvergütung
Für Auszubildende gilt der o.g. Mindestlohn nicht. Hier greift entweder ein tariflich vorgegebenes Entgelt oder folgende gesetzliche Mindestvergütung:
-
1. Lehrjahr 724,00 € (bis 2025: 682,00 €)
-
2. Lehrjahr 854,00 € (bis 2025: 805,00 €)
-
3. Lehrjahr 977,00 € (bis 2025: 921,00 €)
-
4. Lehrjahr 1.014,00 € (bis 2025: 955,00 €)
Aktuell sind keine Änderungen im Bereich der Sozialversicherungs-Beitragssätze bekannt. Insbesondere in der Pflegeversicherung sind Änderungen aber noch möglich. Sollte es hierbei noch zu Änderungen kommen, dann werden wir Sie entsprechend in einem weiteren Newsletter darüber informieren. Im Bereich des individuellen Zusatzbeitrages in der Krankenversicherung wird es darüber hinaus weitere Steigerungen geben. Dieser wird je Krankenkasse individuell festgesetzt.
Die aktuellen Beitragssätze lauten wie folgt:
|
Versicherungszweig |
Beitragssatz |
|---|---|
|
Krankenversicherung |
14,6%* + ind. Zusatzbeitrag je Krankenkasse. |
|
Pflegeversicherung |
3,6%* + 0,6% für Kinderlose abzgl. 0,25% je |
|
Rentenversicherung |
18,6%* |
|
Arbeitslosenversicherung |
2,6%* |
|
Insolvenzgeldumlage |
0,15%* |
* = Diese Beiträge werden jeweils zu 50% vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen.
Wer im Alter noch weiter arbeitet, soll ab dem 01. Januar 2026 steuerlich entlastet werden. Betroffen sind alle Arbeitnehmer, welche die Regelaltersgrenze erreicht haben und weiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Diese sollen zusätzlich zum steuerlichen Grundfreibetrag weitere 2.000,00 € monatlich steuerfrei verdienen dürfen. Ob der Mitarbeiter dabei eine Altersrente bezieht oder diese aufschiebt, ist dabei nicht relevant. Wichtig ist aber, dass dieser Freibetrag nicht für die Sozialversicherung gilt. Diese Änderungen sind aktuell noch nicht durch den Bundesrat und Bundestag beschlossen. Daher kann es hier noch zu Änderungen kommen. Auch die Umsetzung in der Gehaltsabrechnung ist bisher nicht geklärt. Hier informieren wir Sie entsprechend, sobald weitere Informationen vorliegen.
Die Bundesregierung hat im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Steuerpakets vereinbart, dass künftig Zuschläge für Überstunden steuerfrei gestellt werden sollen – nicht jedoch die Grundvergütung der Überstunden. Kernpunkte der geplanten Regelung:
-
Steuerfrei werden sollen die Zuschläge, also der Auf- und Überbetrag, der zusätzlich zum normalen Stundenlohn gezahlt wird (z. B. ein Prozentsatz für Überstunden) – die reguläre Vergütung bleibt steuerpflichtig.
-
Die Steuerfreiheit soll nur für Überstunden gelten, die über die tariflich oder vertraglich vereinbarte Vollzeitarbeitszeit hinaus geleistet werden. Das heißt: Nur Mehrarbeit über die normale Vollzeit hinaus.
-
Für tariflich gebundene Vollzeitkräfte gilt eine Mindestarbeitszeit von 34 Stunden pro Woche; für nicht tarifgebundene gilt 40 Stunden pro Woche als Maßstab.
-
Es wird eine Obergrenze geben: Die steuerfreie Zuschlagskomponente darf einen bestimmten Anteil des Grundlohns für die Überstunden nicht überschreiten (aktuell: 25 %).
-
Wichtig: Sozialversicherungsbeiträge bleiben weiterhin fällig – es geht bislang nur um die Lohnsteuer.
Auch die steuerfreie Teilzeitaufstockungsprämie ist aktuell nicht beschlossen, womit auch hier eine Umsetzung ab 2026 unwahrscheinlich ist. Trotzdem möchten wir auch diese kurz vorstellen. Die Teilzeitaufstockungsprämie soll Mehrarbeit von Teilzeitkräften honorieren und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Durch eine steuerfreie Prämie sollen Beschäftigte motiviert werden, ihre Teilzeitstelle aufzustocken. Prämienzahlungen des Arbeitgebers
für die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit wären bis zu 4.500 € steuerfrei möglich – zusätzlich zum regulären, weiterhin steuerpflichtigen Arbeitslohn. Wichtig ist: Die Arbeitszeiterhöhung muss dauerhaft sein. Geplant ist eine Mindestdauer von 24 Monaten für die Aufstockung. Damit sollen nachhaltige Veränderungen erreicht und Missbrauch vermieden werden.
Voraussetzungen und Umfang der Prämie
Damit die Teilzeitaufstockungsprämie steuer- und sozialabgabenfrei gewährt werden kann,
sind mehrere Bedingungen vorgesehen:
-
Dauerhafte Erhöhung (mind. 24 Monate)
-
Zusätzlich zum Lohn („on top“)
-
Maximal 225 € pro zusätzlicher Stunde
-
Keine Prämie bei kürzlich reduzierter Arbeitszeit
-
Kein rückwirkender Wegfall bei „Störfall“
-
Dokumentation: Die gewährte Prämie muss im Lohnkonto vermerkt werden, um die
Einhaltung des 4.500 €-Höchstbetrags je Arbeitnehmer*in nachweisen zu können.
Bei einer Überlassung eines E-Autos, eines Hybrid-Fahrzeuges oder eines Fahrrades kann
für die Ermittlung der lohnsteuerrechtlichen Besteuerung des geldwerten Vorteils der Bruttolistenlistenpreis halbiert oder geviertelt werden. Entsprechend erstellen wir für Sie auch die Abrechnung und geben die abgerechneten Werte auch in unseren Unterlagen und Exporten für die Finanzbuchhaltung so aus. Allerdings ist umsatzsteuerlich diese Halbierung, bzw. Vierteilung des Bruttolistenpreises nicht vorgesehen. Hier muss also manuell noch die Differenz als Umsatzsteuerbuchung in Ihrer Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Bitte lassen Sie dieses bei sich im Hause überprüfen. Wir können aktuell leider lediglich Beträge für die Finanzbuchhaltung ausgeben, welche auch über die Lohn- und Gehaltsabrechnung gelaufen sind. Sollten Sie allerdings auf unsere neue Software umgestellt sein, so können wir diese Umsatzsteuer-Korrekturbuchungen mit ausgeben. Dazu benötigt Ihr persönlicher Lohnsachbearbeiter dann die Information, bei welchen Fahrzeugen es sich um Elektro- oder Hybridfahrzeuge handelt.