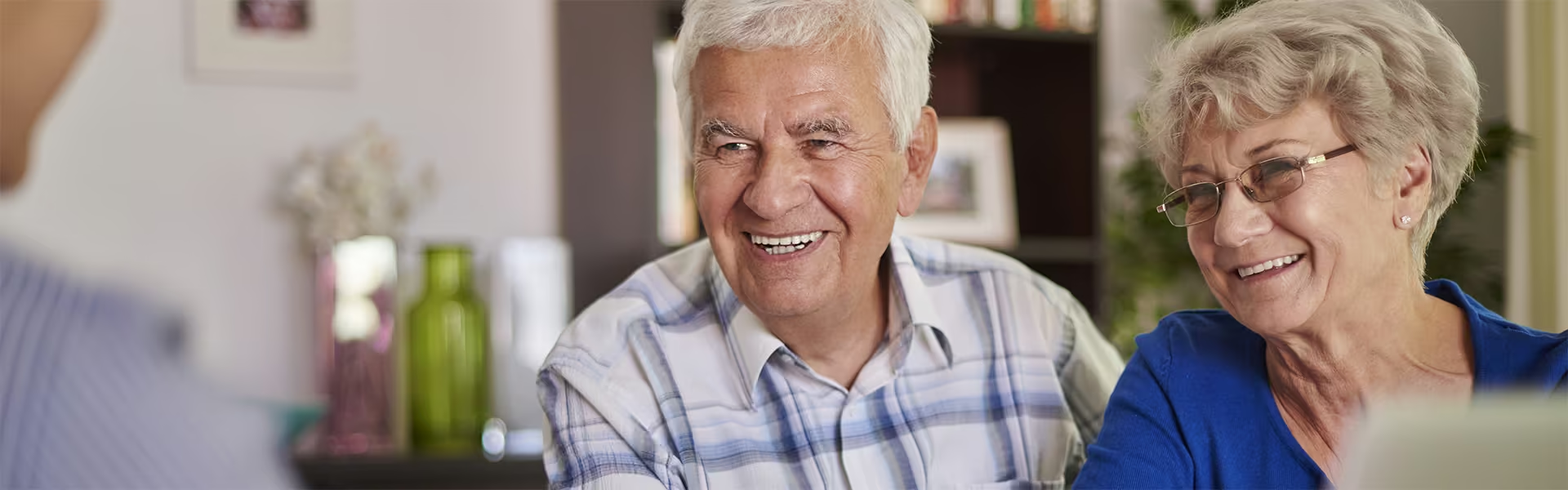In Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten nutzen viele Arbeitnehmer ihren privaten Internetanschluss auch beruflich. Arbeitgeber möchten diese Kosten oft freiwillig ausgleichen, indem sie eine steuerfreie Internetpauschale zahlen. Doch welche rechtlichen Grundlagen gelten hierfür, unter welchen Voraussetzungen bleibt ein Internetzuschuss steuerfrei und wie wird er korrekt in der Lohnabrechnung umgesetzt? Im Folgenden erhalten Arbeitgeber einen fundierten Überblick – inklusive typischer Fallstricke und der Abgrenzung zu anderen Steuererleichterungen im Homeoffice-Umfeld.
Rechtliche Grundlagen der Internetpauschale
Die zentrale gesetzliche Grundlage ist § 3 Nr. 45 Einkommensteuergesetz (EStG). Dieser Paragraph bestimmt, dass die private Nutzung betrieblicher Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte durch Arbeitnehmer lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei bleibt.
Beispiel: Stellt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter einen betrieblichen Internetanschluss oder ein Firmen-Handy zur Verfügung (Vertrag läuft auf den Arbeitgeber), führt die erlaubte Privatnutzung nicht zu einem geldwerten Vorteil – egal wie umfangreich die private Nutzung ist. Wichtig ist lediglich, dass das Gerät bzw. der Anschluss im Eigentum des Arbeitgebers bleibt und nicht an den Arbeitnehmer übereignet wird. In solchen Fällen greift § 3 Nr. 45 EStG und es fallen keine Lohnsteuer oder Sozialabgaben an.
Anders verhält es sich, wenn Arbeitnehmer ihren privaten Internetanschluss beruflich nutzen und der Arbeitgeber hierfür einen Kostenersatz leistet. Auslagenersatz für beruflich veranlasste Kosten kann unter bestimmten Bedingungen steuerfrei bleiben. § 3 Nr. 50 EStG regelt allgemein, dass durchlaufende Posten oder Auslagenersatz des Arbeitgebers steuerfrei sein können, sofern es sich um echte Auslagen für den Arbeitgeber handelt (also Kosten, die eigentlich der Arbeitgeber tragen müsste). Konkret erlauben die Lohnsteuerrichtlinien (Verwaltungsanweisungen) eine Steuerbefreiung für Teile der privaten Telefon- und Internetkosten: R 3.50 Abs. 2 LStR besagt, dass bei regelmäßig beruflicher Nutzung bis zu 20 % der privaten Rechnungsbeträge, maximal 20 € pro Monat, steuerfrei ersetzt werden können – ohne Einzelnachweis. Diese 20 %-Regel gilt für Telekommunikationsaufwendungen im Allgemeinen und umfasst typischerweise Telefonkosten. Bei gemischten Telefon-/Internetanschlüssen können anteilig auch Grundgebühren entsprechend dem ermittelten beruflichen Nutzungsanteil erstattet werden. Alternativ darf der Arbeitgeber den Durchschnittsbetrag eines repräsentativen 3-Monats-Zeitraums an beruflichen Telefon/Internet-Kosten ermitteln und laufend als Pauschale erstatten. Solch ein pauschaler Auslagenersatz bleibt so lange steuerfrei, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern (z. B. Änderung in der Nutzung oder der Kosten). Diese Regeln stützen sich auf R 3.50 LStR und zielen darauf ab, echten Aufwandersatz von steuerpflichtigem Arbeitslohn abzugrenzen.
Eine weitere wichtige Rechtsgrundlage ist § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 EStG, der eine Pauschalversteuerung von Zuschüssen zu Internetkosten ermöglicht. Danach kann der Arbeitgeber einen Internetkostenzuschuss bis zu 50 € pro Monat mit 25 % pauschaler Lohnsteuer versteuern. Für den Arbeitnehmer bleibt dieser Zuschuss dann steuerfrei, und es fallen auch keine Sozialabgaben an. Diese Pauschalversteuerung ist ein Wahlrecht des Arbeitgebers und dient der Steuervereinfachung. Sie findet sich ebenfalls in den Lohnsteuerrichtlinien (R 40.2 Abs. 5 LStR) wieder und erlaubt es, die ansonsten schwierige Aufteilung zwischen privater und beruflicher Internetnutzung zu umgehen. Wichtig: Die 25 %-Pauschalsteuer wird vom Arbeitgeber getragen; für den Arbeitnehmer sind solche Zuschüsse brutto wie netto – also keine Lohnsteuer und auch kein Arbeitslohn im sozialversicherungsrechtlichen Sinne.
Zusammengefasst beruhen steuerfreie Internetpauschalen auf zwei Konzepten: echter Auslagenersatz (steuerfrei nach § 3 Nr. 50 EStG i. V. m. R 3.50 LStR, z. B. 20 €-Regel) und pauschal besteuerte Zuschüsse (steuerfrei beim Mitarbeiter dank § 40 Abs. 2 Nr. 5 EStG, der Arbeitgeber übernimmt 25 % Pauschalsteuer). Beide Varianten erfordern bestimmte Voraussetzungen, damit der Vorteil tatsächlich steuerfrei bzw. pauschal versteuert gewährt werden kann.
Voraussetzungen für die steuerfreie Internetpauschale
Damit ein Internetzuschuss steuerlich anerkannt wird, müssen Arbeitgeber einige Rahmenbedingungen beachten. Die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach gewählter Methode (voll steuerfrei vs. pauschal versteuert), überschneiden sich aber teilweise:
-
Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn: Ein steuerfreier oder pauschalbesteuerter Internetzuschuss darf nur als zusätzliche Leistung gewährt werden. Gehaltsumwandlungen sind unzulässig. Das heißt, der Arbeitgeber darf nicht einfach einen Teil des bisherigen Bruttogehalts in eine „Internetpauschale“ umetikettieren. Der Zuschuss muss on top zum vereinbarten Lohn gezahlt werden.
-
Tatsächliche Kosten des Arbeitnehmers: Der Arbeitnehmer muss tatsächlich privat einen Internetanschluss auf seinen Namen haben und dafür Kosten tragen. Die Höhe des Zuschusses darf die dem Mitarbeiter entstehenden Kosten nicht übersteigen. Es reicht also nicht, eine Pauschale zu zahlen, wenn zuhause gar keine Internetkosten anfallen (z. B. weil der Anschluss über die Familie läuft und der Mitarbeiter nichts zahlt). Im Idealfall lässt sich dies durch Rechnungen oder Vertragsunterlagen belegen.
-
Schriftliche Erklärung des Mitarbeiters: Insbesondere für die Pauschalversteuerung bis 50 € verlangt die Finanzverwaltung eine formlose Erklärung des Arbeitnehmers, dass er einen Internetzugang besitzt und ihm Kosten in bestimmter Höhe entstehen. Bei der 25 %-Pauschale reicht diese schriftliche Bestätigung (sie ist dem Lohnkonto beizufügen) im Grundsatz aus, sofern der Zuschuss 50 € monatlich nicht übersteigt. Darin sollte der Mitarbeiter angeben, welche durchschnittlichen Monatskosten ihm für Internet entstehen. Die Erklärung dient als Nachweis und Beleg im Lohnkonto.
-
Nachweispflichten bei höheren Beträgen: Bis 50 €/Monat sind die Nachweisanforderungen gering – eine einfache Bestätigung des Arbeitnehmers genügt zunächst. Zuschüsse über 50 € im Monat erfordern jedoch einen detaillierten Nachweis der Kosten über einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten. In solchen Fällen sollte der Mitarbeiter z. B. drei Monate lang alle Rechnungen und Aufwendungen dokumentieren. Aus dem Durchschnitt dieser Monate kann dann der Zuschuss berechnet werden. Praktisch kommt ein Betrag über 50 € aber selten vor, da typische Internet-Flatrates meist darunter liegen. Beachten Sie: 50 € sind ein Höchstbetrag, kein pauschaler Freibetrag – es sollte nur so viel gezahlt werden, wie tatsächlich an Kosten anfällt.
-
Berufliche Veranlassung (bei Auslagenersatz): Will man den Zuschuss voll steuerfrei (anstatt pauschal versteuert) gewähren, muss ein beruflicher Nutzungsanteil vorliegen. Bei gelegentlicher Homeoffice-Nutzung wird man einen gewissen beruflichen Anteil an den Internetkosten annehmen können. R 3.50 LStR stellt klar, dass “erfahrungsgemäß beruflich veranlasste Telekommunikationsaufwendungen” vorliegen müssen, damit bis 20 %/20 € ohne Einzelnachweis ersetzt werden dürfen. Während der Corona-Pandemie beispielsweise war klar, dass bei Heimarbeit typischerweise berufliche Internetnutzung anfällt. Arbeitgeber sollten im Zweifel per kurzer Bestätigung festhalten, dass der Mitarbeiter das Internet dienstlich nutzt (z. B. für VPN-Zugang, Videokonferenzen etc.), zumindest an X Tagen pro Woche.
-
Kein Anspruch, freiwillige Leistung: Die steuerfreie Internetpauschale ist eine freiwillige Zusatzleistung des Arbeitgebers. Es besteht kein gesetzlicher Anspruch der Arbeitnehmer darauf. Empfehlenswert ist eine schriftliche Vereinbarung oder Regelung in einer Betriebsvereinbarung, die festhält, unter welchen Bedingungen und in welcher Höhe der Arbeitgeber Internetkosten übernimmt. Dies schafft Transparenz und beugt Missverständnissen vor.
Erfüllen Arbeitgeber diese Voraussetzungen, kann der Internetkostenzuschuss für den Mitarbeiter steuerfrei bleiben, während der Arbeitgeber entweder gar keine Lohnsteuer darauf abführt (bei echtem Auslagenersatz) oder pauschal 25 % Lohnsteuer übernimmt. Wichtig ist, die Grenzen einzuhalten (max. 20 €/Monat steuerfrei bzw. 50 €/Monat pauschal) und die Dokumentation (Mitarbeitererklärung, ggf. Rechnungen) sorgfältig zum Lohnkonto zu nehmen. Andernfalls riskiert man bei Lohnsteuer-Außenprüfungen eine Nachversteuerung.
Mögliche Fallstricke und häufige Fehler
Trotz der oben genannten Vorteile gibt es einige Fallstricke, die Arbeitgeber kennen sollten, um Fehler bei der Anwendung der Internetpauschale zu vermeiden:
-
Kein tatsächlicher Kostenanfall: Der häufigste Fehler ist, einen pauschalen Zuschuss zu zahlen, ohne dass der Arbeitnehmer eigene Internetkosten trägt. Beispielsweise hat der Mitarbeiter keinen eigenen Vertrag oder zahlt gar keine Rechnung (weil der Anschluss etwa über den Partner läuft). In solch einem Fall liegt kein echter Auslagenersatz vor – die Zahlung wäre eigentlich lohnsteuerpflichtig. Die Finanzverwaltung könnte den Zuschuss dann als normalen Bruttoarbeitslohn nachversteuern. Arbeitgeber sollten daher unbedingt verlangen, dass der Anschluss auf den Arbeitnehmer läuft und sich dies bestätigen lassen.
-
Überzahlung über die Kosten hinaus: Eng damit verbunden ist der Fehler, mehr zu erstatten als tatsächlich an Kosten anfällt. Die Pauschale von 50 € ist kein Freifahrtschein – sie darf die echten monatlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers nicht übersteigen. Zahlt der Arbeitgeber z. B. 50 €, der Mitarbeiter hat aber nur eine 30-€-Flatrate, so sind 20 € davon nicht durch Kosten gedeckt. Im Prüfungsfall könnten diese 20 € als steuerpflichtiger Arbeitslohn angesehen werden. Lösung: Zuschusshöhe am besten auf Basis eines Nachweises festlegen (Rechnung einsehen) und im Zweifel den niedrigeren Betrag zahlen.
-
Fehlende Dokumentation: Ein häufiger formeller Mangel ist das Nicht-Aufbewahren der Mitarbeiter-Erklärung oder fehlende Nachweise. Die Lohnsteuer-Außenprüfung wird bei pauschal versteuerten Zuschüssen in der Regel die Bescheinigung des Arbeitnehmers sehen wollen. Wenn diese nicht vorliegt, gerät man in Erklärungsnot. Ebenso sollten bei der 20 €-Regel die 3-Monats-Aufzeichnungen archiviert werden, falls man sich für den Durchschnittsansatz entschieden hat. Empfehlenswert ist es, Kopien der Originalrechnungen zum Lohnkonto zu nehmen – auch wenn bei Beträgen bis 50 € formal nur die Erklärung verlangt ist. Das untermauert die Glaubhaftigkeit und schützt im Streitfall.
-
Gehaltsumwandlung statt Zusatzleistung: Wie oben erwähnt, ist es unzulässig, bestehendes Gehalt in eine Internetpauschale umzuwandeln. Dennoch unterlaufen hier Fehler, etwa wenn eine vereinbarte Gehaltserhöhung kurzerhand als „Internetzulage“ deklariert wird. Die Steuerfreiheit wäre dann nicht gegeben (Verstoß gegen Zusätzlichkeitserfordernis). Achten Sie darauf, dass der Zuschuss immer zusätzlich gewährt und vertraglich klar als freiwillige Leistung ausgewiesen wird.
-
Verwechslung mit Sachbezugsfreigrenze: Manche Arbeitgeber meinen, man könne den Internetzuschuss unter die allgemeine Sachbezugsfreigrenze (50 € monatlich) für steuerfreie Sachbezüge fassen. Dies ist nicht zutreffend, da es sich bei einem Barzuschuss um keinen Sachbezug, sondern um eine Geldleistung handelt. Die 50-€-Freigrenze gilt nur für bestimmte Gutscheine oder Sachleistungen, nicht jedoch für Barerstattungen von Kosten. Der Internetkostenzuschuss muss daher nach den hier beschriebenen speziellen Regeln behandelt werden, nicht nach der Sachbezugsregel.
-
Sonstige Kosten fälschlich einbeziehen: Oftmals entstehen im Homeoffice weitere Kosten (Strom, Heizung, Möbelausstattung etc.). Hier lauert der Fehler, derartige Kosten ebenfalls steuerfrei erstatten zu wollen. Achtung: Für Strom, Heizung oder Mietkosten gibt es keine vergleichbare Steuerfreistellung als Arbeitgeberleistung. Ersetzt der Arbeitgeber z. B. anteilig die Heizkosten oder zahlt er eine Pauschale für das häusliche Arbeitszimmer des Mitarbeiters, ist das steuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn. Solche Aufwendungen können Mitarbeiter allenfalls selbst im Rahmen ihrer Werbungskosten (z. B. mittels Homeoffice-Pauschale oder Arbeitszimmerabzug) geltend machen, aber nicht steuerfrei vom Arbeitgeber erhalten. Ein Fallstrick ist also, die privilegierte Behandlung auf Dinge auszudehnen, die nicht umfasst sind – beschränken Sie die Pauschale wirklich nur auf Internetkosten.
-
Grenzfälle und Prüfung: Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass ein Mitarbeiter falsche Angaben zu seinen Kosten gemacht hat, ist laut Verwaltung grundsätzlich der Mitarbeiter steuerpflichtig, nicht der Arbeitgeber. Dennoch bleibt der Arbeitgeber in der Pflicht, bei der Lohnabrechnung sorgfältig zu verfahren. Im Zweifel ist es besser, die Originalrechnungen einzusehen und zu dokumentieren, um etwaige falsche Angaben zu erkennen. So kann man auch verhindern, unwissentlich zu hohe Pauschalen auszuzahlen.
Zusammengefasst lassen sich Fallstricke durch sorgfältige Dokumentation, realistische Zuschusshöhen und strikte Einhaltung der Voraussetzungen vermeiden. Im Zweifel sollte man steuerlichen Rat einholen oder Rücksprache mit dem Lohnbüro halten, bevor man eine neue Pauschale einführt.
Abgrenzung zu Homeoffice-Pauschale und anderen Steuererleichterungen
Die steuerfreie Internetpauschale ist von anderen steuerlichen Entlastungen im Zusammenhang mit Homeoffice oder mobilem Arbeiten zu unterscheiden:
-
Homeoffice-Pauschale (Arbeitnehmer-Werbungskosten): Seit 2020 gibt es die sogenannte Homeoffice-Pauschale, die inzwischen gesetzlich verankert ist. Ab 2023 können Arbeitnehmer 6 € pro Homeoffice-Tag als Werbungskosten ansetzen, maximal 1.260 € im Jahr, sofern kein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer genutzt wird. Diese Pauschale mindert das zu versteuernde Einkommen im Lohnsteuerjahresausgleich bzw. der Einkommensteuererklärung. Wichtig: Die Homeoffice-Pauschale ist kein Arbeitgeberersatz, sondern ein steuerlicher Abzugsbetrag, den der Arbeitnehmer selbst geltend macht. Sie wird nicht über die Gehaltsabrechnung ausbezahlt, sondern vom Finanzamt bei der Veranlagung berücksichtigt. Ein Arbeitgeber sollte dennoch wissen: Erstattet er seinem Arbeitnehmer Internetkosten steuerfrei oder pauschal versteuert, kann der Arbeitnehmer diese spezifischen Kosten nicht zusätzlich in der Steuererklärung ansetzen (Doppelbegünstigung ist ausgeschlossen). Allerdings betrifft das nur die konkret erstatteten Kosten. Die allgemeine Homeoffice-Pauschale für Tage im Homeoffice kann der Arbeitnehmer unabhängig davon beanspruchen, solange kein Arbeitgeberersatz für dieselben Aufwendungen direkt erfolgt – die Internetpauschale würde also nicht die Homeoffice-Pauschale pro se reduzieren, außer der Arbeitnehmer wollte seine Internetkosten separat als Werbungskosten angeben (was bei Pauschale wenig sinnvoll ist).
-
Häusliches Arbeitszimmer: Eine klassische Steuerentlastung bei beruflicher Heimarbeit ist der Abzug eines häuslichen Arbeitszimmers. Dieser ist jedoch nur möglich, wenn ein abgeschlossener Raum ausschließlich beruflich genutzt wird und seit 2023 zusätzlich der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darin liegt. Wird die strenge Voraussetzung erfüllt, kann der Arbeitnehmer entweder tatsächliche Kosten (Miete, Nebenkosten anteilig) absetzen oder eine Jahrespauschale von 1.260 € (entspricht 105 € pro Monat) geltend machen. Für Arbeitgeber bedeutet das: Eine direkte Erstattung von Arbeitszimmerkosten (z. B. Miete) an den Arbeitnehmer wäre lohnsteuerpflichtig. Stattdessen muss der Mitarbeiter den Abzug selbst über die Steuererklärung vornehmen. Die Internetpauschale deckt nur den Internetzugang ab und hat mit Raumkosten nichts zu tun – sie kann also neben dem Arbeitszimmerabzug gewährt werden, ohne dass sich beides gegenseitig ausschließt. Allerdings: Falls der Arbeitgeber sämtliche Kosten des Homeoffice übernehmen würde (inklusive Internet, Strom, Miete), wäre dies unweigerlich steuerpflichtiger Arbeitslohn; hier kommt ihm die begrenzte Internetpauschale als einziges legitimes Mittel entgegen, zumindest einen Teil der Kosten steuerbegünstigt zu ersetzen.
-
Telefonkosten und Mobilfunk: Oftmals werden neben Internet auch Telefonkosten thematisiert. Für Telefonie gelten ähnliche, teils sogar etwas großzügigere Regeln: Die private Nutzung eines betrieblichen Telefons ist ebenfalls steuerfrei (§ 3 Nr. 45 EStG, analog zum Internetanschluss). Erstattet der Arbeitgeber private Telefongebühren für dienstliche Gespräche, gelten die 20 % bzw. 20-€-Grenzen steuerfrei. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Firmenhandys oder Smartphone-Verträge auf den Arbeitgeber laufen zu lassen – dann sind auch hier sämtliche Privatgespräche steuerfrei, solange kein Ownership-Transfer stattfindet. Diese Telefonkostenerstattungen sind von der Systematik her verwandt mit der Internetpauschale, aber rechtlich getrennt geregelt. Arbeitgeber können beide Instrumente kombinieren: z. B. 20 € steuerfreie Telefonkostenerstattung und 50 € pauschalversteuerte Internetzulage pro Monat parallel, sofern die Voraussetzungen jeweils erfüllt sind.
-
Mobiles Arbeiten im Ausland (Steuerliche Behandlung): Eine etwas andere Thematik betrifft grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten (z. B. Homeoffice aus dem Ausland). Hier spielen Doppelbesteuerungsabkommen und spezielle Konsultationsvereinbarungen eine Rolle – das ist jedoch unabhängig von der hier beschriebenen Internetpauschale. Die Internetpauschale bezieht sich stets auf inländische lohnsteuerliche Regelungen für Sachverhalte im deutschen Einkommensteuerrecht. Andere Länder kennen teils ähnliche Modelle für Arbeitgebererstattungen, aber ein deutscher Arbeitgeber sollte vorsichtig sein, wenn Mitarbeiter vom Ausland aus arbeiten – dann können andere Steuerregeln greifen (dies wäre jedoch Thema für sich und tangiert die innerdeutsche steuerfreie Internetpauschale nicht direkt).