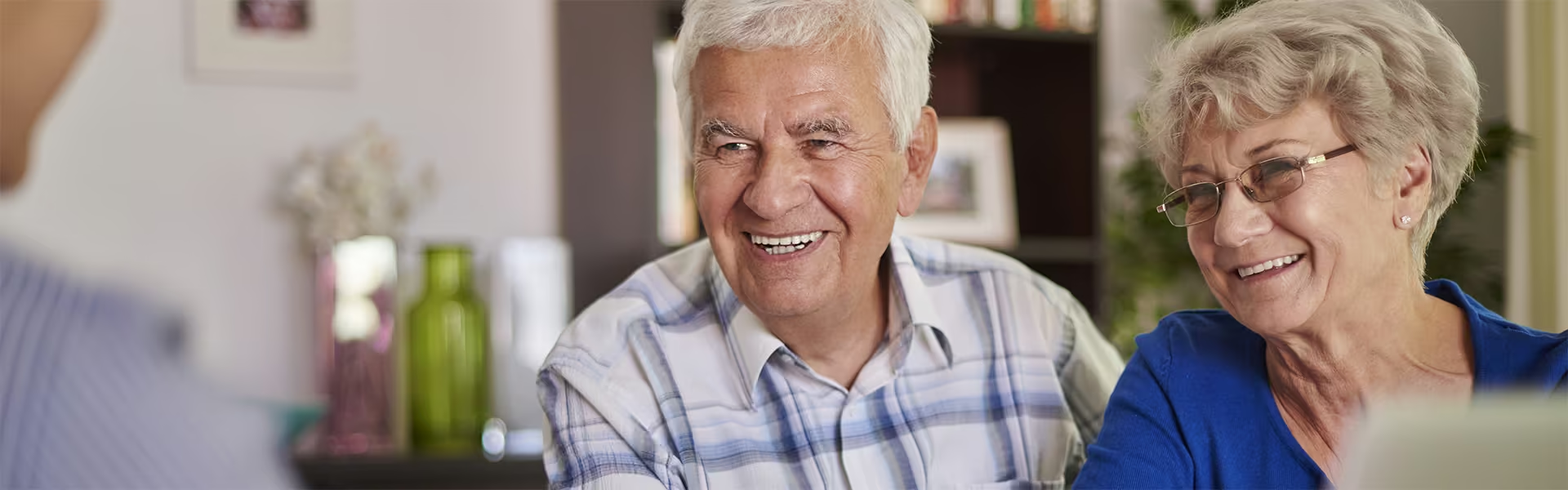Die Bereitstellung von dienstlichen Elektro- oder Hybridfahrzeugen sowie Dienstfahrrädern zur privaten Nutzung führt zu steuerlichen Konsequenzen in zwei Bereichen: Lohnsteuer (Einkommensteuer des Arbeitnehmers) und Umsatzsteuer (für den Arbeitgeber). Wichtig ist, dass die Bemessungsgrundlage – also der Wert, der der Besteuerung zugrunde gelegt wird – in beiden Steuerarten unterschiedlich ermittelt wird. Nachfolgend werden die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand 2025) dargestellt, einschließlich der steuerlichen Vergünstigungen bei der Lohnsteuer sowie der abweichenden Behandlung in der Umsatzsteuer.
Lohnsteuerliche Behandlung von Elektro- und Hybrid-Dienstwagen
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung und für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zur Verfügung, entsteht ein geldwerter Vorteil (Sachbezug), der lohnsteuerpflichtig ist. Dieser geldwerte Vorteil kann pauschal nach der 1-%-Regelung ermittelt werden: Pro Monat wird 1 % des inländischen Bruttolistenpreises des Fahrzeugs (inkl. Sonderausstattung und Umsatzsteuer) zum Zeitpunkt der Erstzulassung als Vorteil angesetzt. Zusätzlich sind ggf. 0,03 % pro Entfernungskilometer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte anzusetzen, wobei auch hier Vergünstigungen gelten können. Alternativ kann der Nutzungswert durch ein Fahrtenbuch anhand der tatsächlichen Kosten ermittelt werden – diese Methode bleibt jedoch aufwändiger und wird hier nicht vertieft.
Für Elektro- und bestimmte Hybridfahrzeuge gelten seit einigen Jahren erhebliche Vergünstigungen bei der Lohnsteuer. Der Gesetzgeber fördert emissionsarme Antriebe, indem er die Bemessungsgrundlage für den zu versteuernden Nutzungsvorteil stark vermindert. Konkret wird bei der Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und Hybridfahrzeugen der ansatzfähige Listenpreis halbiert, teils sogar auf ein Viertel reduziert, was den geldwerten Vorteil entsprechend verringert. Diese ermäßigte Bemessungsgrundlage („Bruchteilsansatz“) ist derzeit bis Ende 2030 befristet. Sie gilt auch anteilig für die oben genannten Kilometer-Pauschalen bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder Familienheimfahrten.
Die Höhe der Vergünstigung hängt vom Fahrzeugtyp und bestimmten Kriterien ab:
-
Reine Elektrofahrzeuge (inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) ohne CO₂-Emission profitieren am meisten. Liegt der Brutto-Listenpreis des Elektroautos unterhalb einer bestimmten Grenze, wird nur 1/4 des Listenpreises als Bemessungsgrundlage angesetzt (entspricht 0,25 % pro Monat statt 1 %). Für erstmalige Anschaffungen bis Ende 2023 lag diese Grenze bei 60.000 €, seit 2024 gilt ein Grenzwert von 70.000 €.
Beispiel: Ein reines E-Auto mit 50.000 € Listenpreis (Anschaffung 2022) wird für die Privatnutzung mit nur 12.500 € (¼) angesetzt, d.h. 125 € pro Monat statt 500 €. Dadurch ergibt sich für den Arbeitnehmer eine deutlich geringere Steuerlast – im Beispiel rund 990 € weniger Lohnsteuer im Jahr (bei 30 % Steuersatz) gegenüber einem vergleichbaren Verbrenner. Überschreitet der Listenpreis die Grenze (z.B. ein teureres E-Fahrzeug über 70.000 €), entfällt die Viertelung; allerdings wird in solchen Fällen immerhin die Hälfte des Listenpreises als Bemessungsgrundlage angesetzt (0,5 % pro Monat).
-
Plug-in-Hybridfahrzeuge (extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge) werden lohnsteuerlich ebenfalls begünstigt, allerdings grundsätzlich mit Halbierung der Bemessungsgrundlage (0,5 % vom Listenpreis pro Monat). Voraussetzung ist, dass das Hybridfahrzeug bestimmte Umweltkriterien erfüllt: Entweder darf der CO₂-Ausstoß max. 50 g/km betragen oder es muss eine Mindest-Elektroreichweite erreichen. Diese Mindestreichweite wurde jüngst verschärft und beträgt für Fahrzeuge, die ab 1. Januar 2025 angeschafft werden, mindestens 80 km (zum Vergleich: 2019–2021 genügten 40 km, 2022–2024 waren 60 km erforderlich). Erfüllt ein Hybrid diese Kriterien nicht, entfällt die Begünstigung – der geldwerte Vorteil wäre dann nach der üblichen 1-%-Regelung vom vollen Listenpreis zu versteuern.
Hinweis: Maßgeblich für die Berechnung ist stets der Bruttolistenpreis inkl. Umsatzsteuer und Sonderausstattung. Bei Elektroautos konnte dieser Listenpreis für vor 2023 angeschaffte Fahrzeuge zusätzlich um einen pauschalen Betrag für das Batteriesystem gemindert werden (abhängig von Batteriekapazität und Anschaffungsjahr). Außerdem sind bestimmte Leistungen rund ums E-Fahrzeug steuerfrei gestellt, etwa das kostenlose Aufladen im Betrieb oder die Überlassung einer privaten Wallbox durch den Arbeitgeber (§ 3 Nr. 46 EStG).
Lohnsteuerliche Behandlung von Diensträdern (Fahrrad/E-Bike)
Auch Dienstfahrräder – also Fahrräder oder E-Bikes, die der Arbeitgeber zur dienstlichen und privaten Nutzung überlässt – genießen seit 2019 steuerliche Vorteile. Hier ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden:
-
Überlassung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn:
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Dienstrad als Extra zum Gehalt zur Verfügung (ohne Gehaltsumwandlung), bleibt der Privatnutzungs-Vorteil steuerfrei. Diese Steuerbefreiung gilt für Fahrräder und E-Bikes (Pedelecs) von 2019 bis Ende 2030. Wichtig ist, dass das Rad tatsächlich zusätzlich zum vereinbarten Lohn gewährt wird und dies vertraglich dokumentiert ist. Achtung: E-Bikes mit Motorunterstützung über 25 km/h (sog. S-Pedelecs), die versicherungs- und zulassungspflichtig sind, zählen verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug. Solche „schnellen“ E-Bikes fallen nicht unter die Steuerbefreiung, sondern werden wie Kfz behandelt (d.h. es gelten die oben beschriebenen Regeln für E-/Hybridfahrzeuge). -
Überlassung im Rahmen einer Gehaltsumwandlung (üblich z.B. beim Dienstrad-Leasing):
Übereignet der Arbeitgeber das Fahrrad nicht extra, sondern der Mitarbeiter verzichtet auf einen Teil seines Bruttogehalts in Höhe der Leasingrate, liegt kein zusätzlicher, steuerfreier Vorteil vor – der geldwerte Vorteil ist steuerpflichtig. Allerdings hat der Gesetzgeber auch hier eine Begünstigung geschaffen: In diesen Fällen muss nur ein Viertel des Bruttolistenpreises des Fahrrads angesetzt werden. Praktisch wird analog zur 1-%-Regel verfahren, aber mit dem viertelten Listenpreis (definiert als die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. USt zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme). Dieser auf 25 % reduzierte Preis wird auf volle 100 € abgerundet, und davon 1 % pro Monat als geldwerter Vorteil versteuert.Beispiel: Hat ein E-Bike einen UVP von 2.100 €, werden davon 25 % (= 525 €) angesetzt, abgerundet auf 500 €. Davon 1 % ergibt 5 € monatlich als geldwerter Vorteil. Zum Vergleich müsste ohne Vergünstigung 1 % von 2.100 € = 21 € monatlich versteuert werden. Die Ersparnis für den Arbeitnehmer ist also erheblich. (Hinweis: Für vor 2019 übernommene Diensträder galt noch die volle 1-%-Regel ohne Viertelung.)
Umsatzsteuerliche Behandlung und abweichende Bemessungsgrundlage
Wird einem Arbeitnehmer ein Firmenwagen oder -fahrrad auch zur Privatnutzung überlassen, stellt dies umsatzsteuerlich eine unentgeltliche Wertabgabe (§ 3 Abs. 9a UStG) dar. Denn der Arbeitgeber verwendet einen Gegenstand aus dem Unternehmensvermögen für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen (Privatnutzung durch den Mitarbeiter). Hat der Arbeitgeber beim Kauf/Leasing des Fahrzeugs oder Fahrrads die Vorsteuer geltend gemacht, muss er nun für die Privatnutzung Umsatzsteuer abführen. Die Bemessungsgrundlage richtet sich in solchen Fällen grundsätzlich nach den Gesamtkosten (§ 10 Abs. 4 UStG) oder es kann eine pauschale Wertansatzmethode verwendet werden, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
In der Praxis erlaubt die Finanzverwaltung eine Vereinfachung, die an die lohnsteuerliche 1-%-Regelung angelehnt ist: Der monatliche Durchschnittswert der privaten Nutzung kann mit 1 % des auf volle 100 € abgerundeten Listenpreises (bzw. UVP) angesetzt werden. Wichtig: Im Gegensatz zur Lohnsteuer gelten die oben erläuterten Viertel- bzw. Halbierungsregelungen hier nicht. Die ermäßigte Bemessungsgrundlage für Elektro-/Hybridfahrzeuge und -räder ist ausdrücklich auf die Einkommensteuer beschränkt und findet bei der Umsatzsteuer keine Anwendung. Der Bundesfinanzhof (BFH) bzw. das BMF haben klargestellt, dass eine Übernahme der reduzierten Werte in die Umsatzsteuer eine unangemessene Begünstigung darstellen würde, da der Unternehmer den vollen Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten hatte. Deshalb muss für die Umsatzsteuer immer der volle Listenpreis als Grundlage herangezogen werden, wenn man die 1-%-Methode nutzt – eine Wertminderung wie bei der Lohnsteuer ist nicht zulässig.
Für die Berechnung bedeutet dies: Man ermittelt 1 % des Bruttolistenpreises (inkl. USt) und versteht diesen Wert als Brutto-Entgelt für die fiktive Leistung an den Mitarbeiter. Daraus ist dann die Umsatzsteuer herauszurechnen.
Beispiel: Beträgt der Listenpreis eines Dienstrads 3.500 €, ergibt 1 % davon 35 € monatlich. Dieser Betrag enthält bereits 19 % USt; netto sind es ca. 29,41 €. Die abzuführende Umsatzsteuer beträgt folglich rund 5,58 € pro Monat. Bei E-Autos verfährt man analog – allerdings auf Basis des vollen (nicht geviertelten/halben) Listenpreises.
Hinweis: Der Arbeitgeber darf natürlich die Vorsteuer aus den Kosten der Anschaffung und Unterhaltung des Dienstwagens/Dienstrads ziehen, soweit betrieblich veranlasst. Die oben beschriebene USt-Abfuhr gleicht diesen Vorteil teilweise wieder aus. Eine kleine Vereinfachungsregel gibt es noch für Fahrräder: Ist der ermittelte monatliche Nutzungswert sehr gering (entspricht einem auf 100 € gerundeten Viertel-Listenpreis unter 500 €), kann auf die Abführung der USt verzichtet werden. In solchen Fällen bleibt jedoch der Vorsteuerabzug für den Arbeitgeber dennoch möglich.
Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Bereich der Lohnsteuer großzügige Vergünstigungen für dienstliche Elektroautos, Plug-in-Hybride und auch Diensträder gelten. Durch reduzierte Bemessungsgrundlagen (0,25 % bzw. 0,5 % statt 1 % vom Listenpreis) wird der zu versteuernde geldwerte Vorteil deutlich gemindert, was die Nutzung umweltfreundlicher Firmenfahrzeuge für Arbeitnehmer attraktiver macht. Diese Regelungen sind aktuell bis 2030 befristet und unterliegen bestimmten Voraussetzungen (Listenpreisgrenzen, Mindestreichweiten etc.).
Umsatzsteuerlich hingegen kann der Arbeitgeber die Privatüberlassung nicht in gleichem Maße begünstigen. Hier muss er – sofern er den Vorsteuerabzug in Anspruch nimmt – auf den vollen Wert der Privatnutzung Umsatzsteuer berechnen. Die Diskrepanz entsteht, weil die Umsatzsteuer den tatsächlichen Verbrauch besteuern soll und der Fiskus eine doppelte Förderung (Vorsteuerabzug und verringerte Bemessungsgrundlage) vermeiden will.